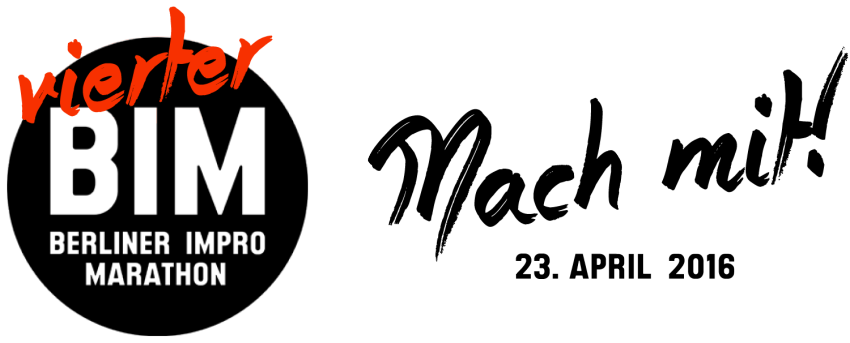Improtheater 105
4. Berliner Impro Marathon. Konzept und Gestaltung.
Am 23. April 2016 gibt es die jetzt 4. Auflage des Berliner Impro Marathon. Ich war wieder in der Orga dabei und bin gespannt, wie unser Konzept funktioniert. Wir haben die Anfangszeit nach hinten verschoben, statt 15:00 geht es jetzt erst 18:00 los. Dafür geht es länger, gespielt wird bis 4:00, danach gibts noch Party bis zum Sonnenaufgang.
Ebenso haben wir noch mehr Sprachen - es gibt jetzt neben deutsch noch englisch, französisch und spanisch. Auch den Anteil der anderen Sprachen ist jetzt deutlich höher. Damit wollen wir die Improszene Berlins weiter zusammen bringen.
Wir haben mit jetzt 20 teilnehmenden Gruppen unser selbstgestecktes Maximum erreicht. Und wir hatten sogar noch einige Anfragen mehr. Dazu wollen wir das Publikum zum mitmachen einladen, es gibt 3 Stunden Open Stage wo auch Zuschauer auf die Bühnen springen können. Tickets gibt es übrigens hier:

Die Musiker sollen auch noch mehr Spaß miteinander haben. So gibt es eine reine Musikbühne und wir hoffen das etliche Shows von mehreren Musikern begleitet werden können. Und meine Gruppe, die Improbanden, sind natürlich auch wieder dabei - zum 4. Mal. Wir gehen die volle Strecke.
Das Layout und den Look hab ich wieder gemacht. Es ist diesmal konkreter gewiorden und spiegelt den Sonnenaufgang in kreativer Weise wieder, Berlin und eine Massenszene aus dem letztem Jahr. Na dann wünsch ich uns mal viel Spaß.
Impro Langform Harold – Teil 4: Bezüge zwischen den Szenen

Harold - Teil 1: Strukur dieser Impro-Langform
Harold - Teil 2: Group Opening
Harold - Teil 3: Die Aufteilung der Beats
Harold - Teil 4: Bezüge zwischen den Szenen
Im letzten Artikel zum Harold haben wir uns mit den verschiedenen Aufgaben der drei Beats beschäftigt. Die drei Geschichtenstränge werden in Beat 2 und 3 wieder aufgenommen und fortgesetzt. Hier lohnt sich ein genauerer Blick. Es gibt mehr Möglichkeiten als nur die gradlinige Weitererzählung der Geschichte, die vielleicht erst einmal am Naheliegendsten erscheint.
Arten des Bezuges auf die vorherige Szene:
- Thematisch
- Charakterlinie
- Zeitlinie
- Berührungspunkt
- Plot
- Game
Themenbezug (Thematic)
Folgt dem Thema der ersten Szene
Die Szene im ersten Beat wird im zweiten und dritten Beat gespiegelt in einem komplett anderen Kontext mit anderen Figuren. Dadurch wird aber auch jedes Mal ein neuer Blickwinkel möglich. Sehen wir zum Beispiel in Beat 1 eine Person, die mit einem teuren Ehering anderen Personen vorschwindelt, glücklich verheiratet zu sein. So könnte in Szene 2 ein Ehering dazu benutzt werden, sexistischen Anmachversuchen zu entgehen. In Szene 3 wird der Ehering benutzt, um Fragen über den gerade verstorbenen Ehepartner zu vermeiden.
Charakterlinie (Character dash)
Folgt einer Figur
Vielleicht haben wir in der ersten Szene eine prägnante und vielschichtige Figur kennengelernt. Dann lohnt es sich, diese Figur weiter zu begleiten. Die folgenden Szenen spielen mit komplett anderen Szenenpartnern. Wir sehen ein runderes Bild der Sicht auf die Welt dieser Hauptfigur. Orts- und Zeitsprünge sind dabei hilfreich.
Zeitlinie (Time dash)
Folgt der Beziehung über die Zeit
In der ersten Szene haben wir die Beziehung zwischen zwei Personen erlebt. Diese Beziehung begleiten wir in beiden Richtungen der Zeitachse und sehen uns an, wie sich die Beziehung und die Figuren dabei wandeln. Hier spielen die gleichen Spieler*innen alle Beats, es können und sollen dann Supportcharaktere auftauchen.
Berührungspunkt (Tangential)
Folgt einem spezifischen Wort
Ist ein spezifisches, also gut unterscheidbares Wort in der ersten Szene gefallen, kann auch das die Verbindung zu den nächsten Szenen sein. Gerade wenn das Wort im Zusammenhang mit dem Thema des Group Openings steht, kann hier der Ideenraum weiter erforscht werden. Es ist die am schwersten zu entdeckene Bezugsart. Deshalb sollte das Wort entweder besonders herausgestellt sein durch Wiederholung, besonderen Fokus in der Szene oder Einzigartigkeit. Schöpfungen neuer Worte bieten sich dafür in jedem Fall an.
Plot
Folgt der Handlung der Geschichte
Das Weitererzählen der Handlung fühlt sich durch Theaterstücke und Film sehr natürlich an. Und in einer Impro-Langform ist ja auch genug Zeit um solch eine Geschichte zu erzählen. Hier sollte darauf geachtet werden, das nicht zwei Spieler die Geschichte allein durcherzählen, denn der Harold ist ein Gruppenwerk. Alle Spieler*innen sollen Spielanteil bekommen. Bei mehr als 6 Mitspielern bedeutet das pro Beat Spielerwechsel geben sollte. Zeit und Ortswechsel helfen dabei. Ich hatte auch einen Trainer am iO, der Plot als Bezug für die schwächste Wahl hielt und das auch prägnant artikulierte. Das seh ich allerdings nicht so.
Game
Folgt dem Komik-Struktur
Hat sich in Beat eins ein Game entwickelt, wird die gleiche Art des Games in Beat zwei und drei wiederverwendet. Die Impro-Schulen der Upright Citizens Brigade (UCB) betrachten das "Find the game" als essentiell und richtet ihren Harold-Ansatz entsprechend darauf aus. Game bezieht sich dabei auf das Finden einer Komik-Struktur, und nicht das Spiel/Game der Kurzform (deshalb lass ich auch Game hier als englischen Begriff stehen).
Einsatz der Bezugsarten im Harold
Beim Harold geht es um Muster - auch in der Form. Das bedeutet, wenn in Szene A2 Tangential benutzt wurde, um auf Szene A1 zu referenzieren, dann sollte A3 ebenso Tangential benutzen. Ebenso ist es schon, für die drei Geschichtsstränge 3 verschiedene Arten des Bezuges zu wählen.
Das bedeutet, das alle Spieler*innen erkennen müssen, was gerade gespielt wurde. Und sich das einprägen für den 3. Beat. Damit kommt zum Inhalt auch noch die Form als Komponente hinzu, die ihr euch merken müßt. Ich fand das unglaublich hart. Es ist zu Beginn ausgesprochen kopflastig das zu versuchen. beim iO wurden unsere Harolds tatsächlich erst einmal schlechter, denn allen rauchte wahnsinnig der Kopf. Allerdings ist unser Gehirn ja ein Wunderwerk, und es wächst mit den Anforderungen. So geht das dann in Automatismus über und wird dann ein tolles Mittel, um jeden Harold sehr unterschiedlich zu gestalten.
Workshop zur Impro Langform in Chicago Style
Wenn euch das Thema Harold mehr interessiert: am 6. und 7. Februar 2016 biete ich in Berlin den Workshop "Impro Langform Wochenende Chicago Style" an. Dort wird sich viel um den Harold drehen, wir experimentieren und nähern und diesem Format. Mehr Details gibt es hier: https://improbanden.de/workshops/impro-langform-wochenende-chicago-style/
Weitere Harold Artikel
Harold - Teil 1: Strukur
Harold - Teil 2: Group Opening
Harold - Teil 3: Die Aufteilung der Beats
Harold - Teil 4: Bezüge zwischen den Szenen
Filme und Serien mit Harold-Struktur
Update:
Auf den Hinweis (Danke dafür) von Tobias Sailer von AMS!-Impro hab ich den Teil Game eingefügt. Weitere Hinweise, Anmerkungen und Fragen könnt ihr auch gern in den Kommentaren hinterlassen.
Comic Biografien von Elke R. Steiner – Radiosendung. Hyperbandrauschen über historische und biografische Comics.

Comic-Zeichnung zur Improshow: Souffleuse von Elke R. Steiner www.steinercomix.de
Comics waren in der Folge 49 meiner monatlichen Radiosendung Hyperbandrauschen das Thema. Ich hatte die Comic-Zeichnerin Elke R. Steiner zu Gast. Wir sprachen über die Struktur und Recherche von historischen und biografischen Comics, mit denen sich Elke beschäftig. Dabei haben wir uns insbesondere ihrem aktuellen Buch „Die anderen Mendelssohns: Karl Mendelssohn Bartholdy“ gewidmet. Wir sprechen aber auch über einige andere Bücher, wie z.B. "Die Giftmischerin" über Gesche Gottfried aus Bremen, "Rendsburg Prinzessinstrasse - Die Geschichte einer jüdischen Kleinstadtgemeinde", "Die anderen Mendelssohns – Dorothea Schlegel, Arnold Mendelssohn" - dem ersten Teil der Mendelsohn-Reihe, "Herbert Lewin und Käte Frankenthal – zwei jüdische Ärzte aus Deutschland". Ebenso sprechen wir kurz über das Projekt "Respekt - Internationale Comics" das 2011 vom Goethe Institut Moskau mit Partnern initiiert wurde und weiterhin aktiv ist.
Hier geht es zur Sendung: https://hybr.de/?p=247
Comic-Workshops
Elke und ich sprechen aber nicht nur über ihre zahlreichen veröffentlichten Bücher. Es geht ebenso um Comic-Workshops und was in diesen Workshops alles vermittelt werden kann. Dabei reicht die Spannweite von Kindern und Jugendlichen bis zu Erwachsenen im hohen Alter. Themen können dabei sowohl aktuell politische sein wie auch gleichzeitig Wissen und Bildung zu bestimmten Bereichen vermitteln. Und ebenso kommen wir auf das Thema Russland, denn auch dort hat Elke diverse Workshops geleitet. Und es ist dort durchaus schwierig und gefährlich, zu bestimmten Themen wie der LGTB-Community oder der Stalinzeit sich frei durch solch ein Medium zu äußern.
Livezeichnen und Improvisation
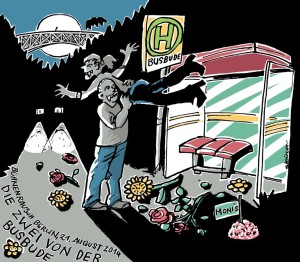
Überra(u)schungsshow von Elke Renate Steiner https://steinercomix.de
Ebenso interessant ist das Thema Livezeichnen. Elke erzählt, wie das im Ansatz funktioniert, Konferenzen, Workshops oder Events als Comiczeichner live zu reflektieren. Und hier kam auch Improtheater kam kurz vor, denn Elke hat auch die Improbanden und Improshows schon gezeichnet, wie ihr hier seht. Was ein wirklich toller moment ist, hinterher so ein detailliertes Bild zu bekommen. Aber auch die Techniken von Improtheater dienen Elke als Inspiration für Workshops und Geschichten.
Also hört doch mal rein oder schaut auf www.steinercomix.de mal vorbei<.
Impro Langform Harold – Teil 3: Die Aufteilung der Beats. Die Impro Langform Harold genauer betrachtet.

Harold - Teil 1: Strukur dieser Impro-Langform
Harold - Teil 2: Group Opening
Harold - Teil 3: Die Aufteilung der Beats
Harold – Teil 4: Bezüge zwischen den Szenen
Das Group Opening hat mit Schwung und Energie das Thema des Harolds umrissen. Jetzt folgen die Szenen des ersten Beats in dieser Impro Langform. Dazu es ist interessant, noch einmal zurückzutreten und die Zielrichtung der drei Beat-Phasen zu betrachten:
1. Beat: Create
2. Beat: Explore
3. Beat: Connect
Der erste Beat des Harold: Create
Im ersten Beat werden die Plattformen gebaut. Es wird hier auch von "Grounded Scenes" gesprochen. Es empfehlen sich Zweierszenen. Die können ruhig etwas länger sein und es gibt keine Tagouts. Die Szenen sollen möglichst spezifisch die Grundlagen definieren. Dazu gehören die klassischen 5 Ws, also: Wer? Wo? Welche Beziehung haben sie zueinander? Um was geht es? Und warum?. Da die Szene nicht zwingend weitergespielt wird in den weiteren Beats sollte sie eine eigene Sinneinheit bilden. Je spezifischer Teile definiert werden, desto besser. Inhaltlich bezieht sich der erste Beat auf die Themen, die im Group Opening gemeinsam gefunden worden. Allerdings werden diese Ideen nicht direkt übernommen sondern abgewandelt.
Der zweite Beat des Harold: Explore
Im zweiten Beat werden die Möglichkeiten erforscht, die in den ersten Szenen angelegt worden. Es können Zweier- wie auch Mehrpersonen-Szenen entstehen. Es sind Tagouts möglich, um mehrere Szenen für einen Erzählstrang zu spielen. Die Szenen können insgesamt auch schneller sein als im ersten Beat. Insbesondere wenn viele Spieler beteiligt sind, sollte nicht die gleiche Spielerkonstellation wie wie im ersten Beat beginnen. Also spielen Szene A1 zwei Spielerinnen, kann höchstens eine der beiden in Szene A2 beginnen. Damit werden alle Spieler des Teams eingebunden. Zusätzlich werden die Sichtebenen auf das Grundthema vielschichtiger. und es kommen Zeitsprünge und Ortswechsel wie von allein. Denn hier im zweiten Beat ist die Zeit dafür, das Thema durch die Figuren vielschichtig zu beleuchten.
Der dritte Beat des Harold: Connect
Der dritte Beat ist nochmal schneller. Bisher liefen die Geschichten parallel. Jetzt können sich einzelne Teile verknüpfen. Der Ort von Strang A taucht kurz in Strang C auf. Eine Figur aus Strang B ist plötzlich auch eine Nebenrolle in Strang A. Es verknüpfen sich die Geschichten zu einem Ganzen. Dabei ist es gut, Raum für Interpretation zu lassen. Die Köpfe der Zuschauer füllen das gern und bieten Gelegenheit zum anschließenden Reflektieren. Trotzdem wird auch im dritten Beat das Grundthema weiter beleuchtet. Es ist die letzte Möglichkeit, Motivationen einzelner Charaktere aufzuzeigen und die Geschichten abzurunden.
Workshop zur Impro Langform in Chicago Style
Wenn euch das Thema Harold mehr interessiert: am 6. und 7. Februar 2016 biete ich in Berlin den Workshop "Impro Langform Wochenende Chicago Style" an. Dort wird sich viel um den Harold drehen, wir experimentieren und nähern und diesem Format. Mehr Details gibt es hier: https://improbanden.de/workshops/impro-langform-wochenende-chicago-style/
Weitere Harold Artikel
Harold - Teil 1: Strukur
Harold - Teil 2: Group Opening
Harold - Teil 3: Die Aufteilung der Beats
Harold – Teil 4: Bezüge zwischen den Szenen
Filme und Serien mit Harold-Struktur
Impro Langform Poster
Improtheater kann pure Schönheit sein. Dieses Poster im minmalistischen Flat Design Stil ist mein neuestes Werk. Mit den Strukturen von neun Impro-Langformen gibt es das nun als Druck hier zu bestellen. Es ist etwa 90 cm und 60 cm breit und auf hochwertigem matten Papier in Museumsqualität gedruckt. Darauf sind die Strukturen von berühmten und vielleicht auch weniger bekannten Langformen - Improspielerinnen und Improspieler mögen das. Es passt ebenso in Probe- oder Unterrichtsräume und ist mit Sicherheit ein ideales Geschenk, Weihnachten ist ja nicht mehr fern. An Hand der Stukuren könnt ihr das ein oder andere Format euch vielleicht erschließen, manches ist natürlich auch komplexer und bedarf ausführlicher Erläuterung von einem*r Trainer*in.
Diese Langformen sind sind auf dem Poster
 Bei Campfire oder auf deutsch Lagerfeuer sitzen die Charaktere an einem Lagerfeuer und erzählen sich Geschichten, die dann natürlich ausgespielt werden. Es kann gern gruselig und angsteinflößend bis horrorhaft werden.
Bei Campfire oder auf deutsch Lagerfeuer sitzen die Charaktere an einem Lagerfeuer und erzählen sich Geschichten, die dann natürlich ausgespielt werden. Es kann gern gruselig und angsteinflößend bis horrorhaft werden.
Deconstruction basiert auf einer langen Basisszene, in der alle Informationen vorkommen, die danach in verschiedenen Phasen dekonstruiert werden. Das ist ein sehr komplexes Format.
Die Langform La Ronde bzw. Reigen beruht auf der Struktur des gleichnamigen Theaterstücks von Arthur Schnitzler. Dabei verläßt immer ein Charakter eine Zweierszene und ein neuer Charakter kommt hinzu, bis der Letzte und der erste Charakter aufeinander treffen und den Reigen schließen.
Die Monoscene ist ein Einakter ohne Schnitte, also eine durchgehende Szene. Dabei können wie beim Format "Naked Stage" Spieler auf- und abgehen, oder wie bei "No Exit" Charaktere die gesamte Zeit im Handlungsort verweilen.
Der Harold ist die älteste und berühmteste Langform, die im Wechsel zwischen Group Games und Szenen zu einem Thema ein theatrales Stück entstehen läßt. Der Harold hat einen sehr hohen Freiheitsgrad, die Struktur ist ebenfalls wandelbar und wird eigentlich nur zu Unterrichtszwecken so vermittelt.
Beim Appartment Building bzw. Mietshaus blicken die Zuschauer in 3 oder 4 Wohnungen eines Hauses und den sich darin entwickelnden Geschichten. Durch die nachbarschaftliche Nähe können sich die Charaktere der einzelnen Stories begegnen, bzw. Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel erleben.
Die Montage ist eine sehr lose Struktur. Die Szenen müssen sich nicht aufeinander beziehen, können aber ggf. auch wieder aufgenommen werden oder Charakter kommen wiederholt zurück.
Die Langform Asssscat 3000 basiert auf dem Armando. Ein Monolog liefert die Detailinformationen für diverse Szenen, die diese Details assoziert benutzen, bis wieder ein Monolog die Szenen unterbricht, dem wiederum Szenen folgen. Dabei kann jeder Spieler zum Monologist werden.
The Bat oder auch Harold in the Dark ist die Haroldstruktur gespielt mit geschlossenen Augen bzw. im dunklen Raum. Da hier schnelle Szenenwechsel schwieriger sind, einstehen oft weniger Schnitte und längere Erzählstrukturen.
Hier geht es zum Poster:
Shop.
Die drei Fotos oben stammen übrigens von der wundervollen Tash.
Vortrag auf dem Chaos Communication Camp 2015

Das Chaos Communication Camp findet ja nur alle 4 Jahre in der Nähe von Berlin statt. Diesmal fiel es auch noch zusammen mit dem 20. Geburtstag der c-base. Ich war diesmal sehr gut beschäftigt. Ein 60 Minuten Powervortrag zur Geschichte der c-base sowie die Moderation der Abendveranstaltung zum Geburtstag auf der BER-Stage waren der Auftakt. Dann kam der Improteil. Der Track "Failosophy" rief förmlich uns Improbanden und lud uns ein. So kam an Tag 3 ein wirklich schöner Impro-Workshop zum Thema "Umarme Fehler" hinzu und an Tag 4 eine Open Stage Improtheater-Show im Riesenzelt Project 2501.
EnthusiastiCon: Was uns am programmieren begeistert. und wie mich Improtheater zu einem besseren Entwickler macht.
![]()
Die Wikimedia ruft zur EnthusiastiCon. Die Konferenz findet vom 19.-21. Juni 2015 in Berlin statt. Eine wirklich schöne Idee für eine Konferenz: es dreht sich um Begeisterung. Und es soll von Entwicklern für Entwickler sein. Dabei ist jeder Vortrag nur 10 Minuten lang - was ein interessanter Ansatz und auch eine harte Vorgabe für uns Sprecher ist.
Es gibt verschiedene inhaltliche Sektionen:
- Clever hacks!
- Brainy stuff!
- Our craft and us
- Building things with Open Data
- Deep Relationships & Meaningful code
Ich verbinde meine beiden Leidenschaften und spreche zum Thema: "How improv theater makes me a better developer" (Panel "Our craft and us"). Denn Impro spielen und Entwickler (im Team) sein haben eine Menge gemeinsam. Ihr werdet es hoffentlich sehen und hören, also kommt vorbei.
UPDATE: Diese Tweets von SourceCodeBerlin haben einige Punkte sehr schön getroffen:
There are Similarities between improv theatre and programming @macrone #EnthusiastiCon
— SourceCodeBerlin (@SrcCodeBerlin) 20. Juni 2015
Improv theatre comes out of nothing and turns into magic, just like programming said @macrone #EnthusiastiCon
— SourceCodeBerlin (@SrcCodeBerlin) 20. Juni 2015
Audience connect with us through feedback during the process of programming a product, just like in improv theatre @macrone #EnthusiastiCon
— SourceCodeBerlin (@SrcCodeBerlin) 20. Juni 2015
If we are positive programmers then we are much more productive said @macrone #EnthusiastiCon
— SourceCodeBerlin (@SrcCodeBerlin) 20. Juni 2015
Imprint: Die Grafik ist von Sven Sedivy - CC-BY-SA 4.0
Teamwork-Skills für IT-Professionals

IT-Professionals sind nach wie vor heiß begehrt und finden häufig ohne größere Schwierigkeiten einen Job. Eine Umfrage aus dem Jahr 2013 besagt, das Entwickler*innen trotzdem sehr daran interessiert sein sollten, ihre sozialen Fähigkeiten zu verbessern.
2013 fand eine Umfrage unter 2.300 Chief Information Officers (CIOs - also Leitern von IT-Departments) statt, deren Unternehmen mehr als 100 Mitarbeiter in den USA aufweisen.
Dabei gaben 30% der CIOs an, dass bei Neueinsteiger*innen 30% zu geringe technische Fähigkeiten und 17% ungenügende Soft-Skills und Teamfähigkeit mitbringen. Trotzdem sei ein Großteil der Jobeinsteiger*innen gut qualifiziert und direkt beim Arbeitsbeginn effektiv einsetzbar. Um so erstaunlicher war, das 63% der IT-Leiter angaben, in diesem Jahr keine Neueinsteiger*innnen einstellen zu wollen.
"IT Personalleiter suchen Kandidaten, die nicht nur technische Fähigkeiten mitbringen, sondern auch Deadlines halten und gut mit Kunden und Kollegen zusammenarbeiten können," sagt John Reed, Senior Executive Director bei Robert Half Technologies, der die Umfrage durchführte. "Neue IT-Absolventen können sich auf dem Job-Markt hervorheben, wenn sie Scharfsinn für's Geschäft und solide zwischenmenschliche Fähigkeiten demonstrieren können."
Reed sagt, IT-Worker können ihre Chancen, einen Job zu bekommen und zu behalten, deutlich erhöhen, wenn sie sich auf folgende Bereiche fokussieren:
Kommunikation: Es scheint offensichtlich, dass die Fähigkeit, sich schriftlich und mündlich auszudrücken, eine Grundvoraussetzung ist. Dennoch bringen nicht alle IT-ler diese Fähigkeit mit. Zu ihr gehört auch, gegenüber Nicht-Experten nicht unverständlich in Fachtermini zu sprechen.
Konfliktlösung: In jeder noch so gut funktionierenden Gruppe gibt es auch mal Konflikte. Wer dabei ruhig und besonnen agiert und für alle akzeptable Kompromisse finden kann, hat deutliche Pluspunkte.
Teamwork: Hilfe für einen Kollegen bei einem wichtigen Projekt anzubieten, ist ein Zeichen für einen starken Zusammenhalt innerhalb des Teams.
Diplomatie: Ein professioneller Umgangston in der Kommunikation mit Kollegen und Kunden, sowohl mündlich wie schriftlich, sind elementar - ebenso wie die Fähigkeit, auch einmal den Mund zu halten, wenn man gerade frustriert oder wütend ist.
Viele dieser Fähigkeiten sind erlernbar. Übungen aus dem Improvisationstheater bieten sich an, um in einer geschützten Gruppe an diesen Themen zu arbeiten. Und das macht dabei auch noch Spaß, denn so lernt es sich viel besser. Claudia Hoppe und ich bieten am 21. und 22.2.2015 einen Kurs an: Kollaboratives Spiel für IT-Professionals, in dem einige dieser Fähigkeiten erleb- und erlernbar werden.
Method Acting und Impro

Am Wochenende habe ich einen dreitägigen Workshop Method Acting nach Lee Strasberg bei Mona Glass absolviert. Natürlich kann in so kurzer Zeit nur ein kleiner Einblick erfolgen, trotzdem war es interessant und die kurzen Szenen die entstanden teilweise wirklich beeindruckend.
Beim Method Acting geht es um das Schauspiel von innen nach außen - also an Hand eigener Erfahrungen, Sinneseindrücke und Emotionen soll der zu spielende Character entstehen (im Gegensatz dazu die Arbeit von außen nach innen meint z.B. Beobachtung anderer Personen um dadurch das eigene Spiel zu gestalten).
Method Acting benutzt dazu Entspannungs- und Erinnerungstechniken. So haben wir uns erst intensiv erwärmt (Tanzen, Gesichtsgymnastik, Stimmübungen, Stuhlentspannung), dann uns unserer jeweiligen Rolle angenähert. Wir haben zentrale Sätze der Figur in verschiedenen Emotionen gesprochen und uns mit einem Partner über die jeweilige Rolle unterhalten. Das war ein intensiver Einstieg in die Texte. In einem Fragenkatalog zu unserer Figur sollten so spezifisch wie möglich Einzelheiten definiert werden.
Ein Tier, das dem Character entspricht wurde gewählt und spielerisch dargestellt, ebenso eine Alltagssituation des Charakters. Ein Interview in der Rolle folgte am zweiten Tag. Die Konturen der Figuren wurden schärfer, die Charaktere unterschieden sich jetzt deutlich von den Spielern.
Am dritten Tag wurden mit den Mitteln des Sense Memory und des Emotional Memory noch mehr innere Anknüpfungspunkte an die Rolle hergestellt. Erst jetzt ging es an Szenenarbeit - in jeweils passendem Kostüm und Schuhen. Die Ergebnisse waren sehr stark. Beeindruckend wie gut das funktionierte.
Was nehme ich daraus mit fürs Impro? Vieles. Der Schauspielaspekt tritt ja immer etwas in den Hintergrund zugunsten des Trainings der Improfähigkeiten. Diese Gewichtung werde ich überdenken. Es war für den Geist bereichernd sich mit einem festen Text auseinanderzusetzen. Dabei waren die Dinge, die es zu definieren gab durchaus ähnlich denen einer Improszene, nur eben mit mehr Zeit. Das Gestalten der Figur, das Abwägen der Möglichkeiten, das sich eindringlich in die Figur versetzen schafft am Ende einen wahrhaftigen und vielschichtigen Charakter. Ich hätte von allen gern mehr gesehen, denn auch beim Zuschauen lernt man Rollen kennen und lieben.
Einige der Methoden habe ich schon im Improkontext gemacht - speziell die Tierübung. Trotzdem hatte ich noch nie eine solch gelungene Integration in eine Rolle. Ebenso funktionierten Improübungen mit diesen fixen Charakteren sehr gut. Die Figuren blieben stark, die Rollen passten in der Szene überaus gut zusammen. Ich denke es lohnt sich, gelegentlich an fertigen Texten Impro zu üben - eine Erkenntnis, die mich selbst überrascht.
Impro und Sprachen
In der letzten wie auch in dieser Woche führte ich interessante Interviews mit Good Luck, Barbara! und Abigel Paul, die in Deutschland - konkret Berlin und Frankfurt - Impro auf englisch spielen, was jeweils ihre Muttersprache ist. Beide waren sich einig, das es ein paar Unterschiede gibt. Kulturelle Referenzen fallen weg, weil sie nicht sicher verstanden werden. Dazu zählen auch Referenzen auf das Leben hier, denn die Zuschauer müssen nicht zwingend hier wohnen. Damit verlagert sich das Spiel auf die großen Themen der Menschlichkeit, die universeller sind. Good Luck, Barbara! - die Berliner Interview-Partner, sprachen sogar davon, durch das bewußtere auswählen der Themen langsamer und physischer zu spielen. Kein schlechter Tausch. Ein Beispiel das Begrenzung kreatives Potential entfacht.
Den Artikel Good Luck, Barbara! - englischsprachige Impro-Langform in Berlin findet ihr bereits auf Impro-News.de, das Interview mit Abigel folgt noch.